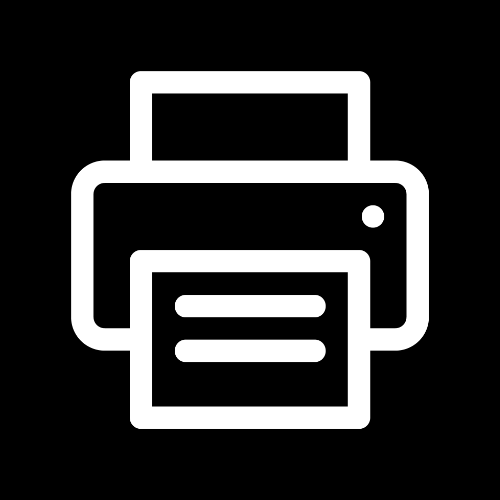Geplante Obsoleszenz - Über die Verödung des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks
Kristoffer Cornils, Veröffentlicht: 07. Juli 2023
(Aktualisiert: 13. August 2023)
Der ÖRR steckt tief in der Krise. Der neue Vorsitzende Kai Gniffke verspricht zwar Großes für zumindest die ARD, doch wird das notgedrungen auf Kosten des Programms gehen – und derer, die es umsetzen. Und bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass der große Innovationsschub in die falsche Richtung zeigt, kommentiert Kristoffer Cornils.
Kai Gniffke muss einen stressigen Arbeitsalltag haben, hat er seinen Job als Vorsitzender der ARD doch in einem der kritischsten Momente des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks (ÖRR) überhaupt aufgenommen. Der Skandal um Patricia Schlesinger hat eine breitere Debatte um den Umgang mit Geldern aus dem Rundfunkbeitrag losgetreten, die in rechtspopulistischen Kreisen schon seit langem schwelt. Dazu kommt eine seit Ende 2021 nur kaum kontrollierbare Inflation, die das weitgehend gleich bleibende Budget des ÖRR sukzessive schrumpfen lässt.
Es fehlt also an Geld und auch an Vertrauen und ausreichendem Rückhalt, um noch mehr einzufordern. Dabei bräuchte es doch gerade jetzt Investitionen in Innovation – ein neues, tragfähiges Modell für den ÖRR der Zukunft. Nun liegt es an dem neuen Mann an der Spitze, zumindest die ARD in die Zukunft zu führen. Dafür hat er große Pläne: Mehr Kooperation mit dem ZDF, ein umfassendes Streaming-Angebot, mehr Digitalisierung insgesamt und vielleicht auch Konzessionen an den freien Markt.
Gniffke scheint allerdings nicht sonderlich stressresistent. Bei einem Roundtable des ZAPP – Das Medienmagazin unter dem Titel »Zu teuer, zu groß, zu einseitig? Die Zukunft der ARD« wurde das schon nach exakt 3.35 Minuten klar. Eine gute Dreiviertelstunde später wurde er endgültig unwirsch. Der Anlass? Eine Frage nach seinem Jahresgehalt1, rund 360.000 Euro und damit ähnlich viel wie das des Bundeskanzlers, wie Ko-Moderator Tilo Jung anmerkte.
Er könne dazu nichts sagen, gab Gniffke zurück, darüber entscheide sein Verwaltungsrat. Eben jener, das fügte er doch hinzu, könne allerdings »erwarten, dass da jemand ist, der sich das letzte Hemd dafür zerreißt, dass wir beim Publikum sind, dass ich bei 5.000 Mitarbeitenden bin.« Nun entspricht ein geplatzter Kragen noch keinem zerrissenen Hemd und wie publikumsnah solche Auftritte Gniffke machen, wird in den Kommentarspalten ausgehandelt.
Interessant allerdings war der nachgeschobene Zusatz zu den »5.000 Mitarbeitenden«, denen Gniffke »verdammt viel abverlange« – eine bemerkenswerte Rechtfertigung für ein sechsstelliges Jahresgehalt. Über diese »Mitarbeitenden« wird seltener gesprochen, wenn mal wieder über den ÖRR debattiert wird. Das sollte es aber. Sind es doch sie, die die großen Pläne Gniffkes umsetzen werden müssen.
Ihnen wird viel abverlangt und im Grunde aber wenig gegeben: Die Arbeit mehrt sich, die Perspektiven schrumpfen. Und das ist inmitten einer Gemengelage verschiedener Probleme beim ÖRR das vielleicht größte überhaupt.
Die große Krise
Aber wer genau gehört eigentlich zu diesen »Mitarbeitenden«? Beim SWR, dem Gniffke weiterhin als Intendant vorsteht, arbeiteten laut Kennzahlen der ARD für das Jahr 20212 rund 3.750 Festangestellte, gut drei Viertel davon in Vollzeit. Die Interessenvertretung ARD-FREIE nennt überdies eine Zahl von 1.850 sogenannten Festen Freien3.
Bei Festen Freien handelt es sich um Menschen, die vom ÖRR auf Honorarbasis beschäftigt, aber nicht bei ihm angestellt sind. Die ihm lohn- und sozialversicherungspflichtig in festen Dienstplanstrukturen verpflichtet sind, aber kein volles Urlaubsgeld beziehen und im Krankheitsfall nicht den vollen Ausgleich erhalten. Die jenseits ihrer Dienstpläne keine Sicherheit haben, noch weiter für den ÖRR arbeiten zu können.
Die insgesamt etwas mehr als 5.000 »Mitarbeitenden« Gniffkes setzen sich also als Menschen zusammen, von denen rund zwei Drittel eine reguläre Anstellung haben und einem Drittel, das im Grunde prekär arbeitet. Das ist nicht nur beim SWR so: Auf knapp 28.000 Festangestellte kommen im gesamten ÖRR 18.000 Feste Freie. Das System basiert auf der Mitarbeit der Festen Freien, oder besser gesagt wird es durch sie überhaupt erst ermöglicht.
Mehr noch stellen eben jene Feste Freie wohl auch »Die Zukunft der ARD« dar, und nicht allein, weil vermutlich die meisten von ihnen den redaktionellen und planerischen Alltag mitbestimmen. Der Altersdurchschnitt unter den Festangestellten beträgt rund 50 Jahre, ein nicht unwesentlicher Teil von ihnen geht also bereits auf die Pensionierung zu. Der Nachwuchs arbeitet deshalb wohl weitgehend auf Honorarbasis. Und einer ungewissen beruflichen Zukunft entgegen.
Viel Hoffnung kann er sich angesichts der großen Krise nicht machen. Als deren logische Konsequenz sind zuerst Sparmaßnahmen zu erwarten, das heißt konkret: Streichungen von Programmen und die zunehmenden Zusammenlegung verschiedener Angebote, Downsizing unter den »Mitarbeitenden« und der Kürzung von Etats für die Arbeit mit Freelancer:innen, von denen eine unbekannte Zahl das Tagesgeschäft der Redaktionen mit ihren Perspektiven bereichert.
Kurzum stehen die Zeichen auf Rationalisierung und in der irrationalen Folge auf mehr Arbeit, die auf noch weniger Rücken ausgetragen wird. Ansätze einer solchen Austeritätspolitik sind schon länger zu beobachten. Der NDR wird bis 2028 zehn Prozent seines Personals einsparen4, noch eher werden beim rbb hundert Stellen gekürzt5. Dazu gesellen sich andere Beispiele aus dem ÖRR wie die Anfang des Jahres angekündigte Einstellung des deutsch-französischen Kulturmagazins Tracks von arte6. Von allen Fronten also werden immer mehr Hiobsbotschaften verkündet, während durch den Flurfunk schon die nächsten geflüstert werden.
Nun hatte Gniffke offensichtlich anderes vor, als von Tilo Jung und Kathrin Drehkopf ausgerechnet in einem NDR-Programm dermaßen unter Stress gesetzt zu werden. Er wollte wohl eigentlich mit Begriffen wie »Transformationsprozesse« um sich werfen und Visionen eines Streaming-Angebots vor ihnen ausbreiten, hinter denen sich voraussichtlich bloße Streamlining-Bemühungen verbergen. Er war gekommen, um Innovationspotenziale in den Raum zu stellen und füllte ihn dann doch nur mit mangelnder Kritikfähigkeit.
Am Ende stand dann also weniger Hoffnung als vielmehr Ernüchterung: Dieser Mann wird die ARD wohl kaum davor bewahren, obsolet zu werden. Aber vielleicht geht es sowieso schon längst darum, sie und den ÖRR insgesamt in die Obsoleszenz zu führen. Insbesondere im Hörfunk ist das bereits im Gange.
Die große Durchhörbarkeit
83 Rundfunksender bietet der ÖRR und darüber muss sicherlich nicht alles doppelt und dreifach von den verschiedenen Redaktionen aufbereitet werden. Aber die unvergleichliche regionalspezifische Abdeckung dieses Angebots bietet Chancen, die historisch betrachtet kaum genutzt wurden. Bietet sich doch eine Infrastruktur, über die sich gerade in der Krise damit experimentieren ließen könnte, wie sich der ÖRR über den Hörfunk – ob strikt linear oder über die sich noch im Aufbau befindlichen crossmedialen Angeboten – als veritable Alternative zu dem präsentieren, was das Privatradio wie auch die Streaming-Plattformen bieten.
Die jetzige Krise ist auch eine Auswirkung der Veränderungen auf dem deutschen Medienmarkt Ende der achtziger Jahre. Mit der Einführung des dualen Systems, das heißt der Aufteilung des Medienmarkts in einen privaten und einen öffentlich-rechtlichen Bereich, sicherte der ÖRR ab den frühen Neunzigern zuerst seine Bestandskundschaft durch die Imitation des Privatradios ab. Der rbb etwa startete Fritz und der WDR mit 1LIVE eine der größten Erfolgsgeschichten des öffentlichen Hörfunks, indem sie sich dem Sound der neuen Konkurrenz anglichen.
Schon in dieser Zeit mutierte der Begriff der »Durchhörbarkeit« – mehr Pop, mehr lockere Themen, mehr gute Laune bei der Moderation – zum Kampfbegriff. An seiner Brisanz hat er im Kontext des ÖRR nichts verloren, an seiner Schlagkraft allerdings schon. Zuletzt warf ihn Programmchefin Mira Seidel in den Ring. Die Jugendwelle DASDING von Gniffkes SWR müsse im »Tagesprogramm (...) gefälliger werden«, sagte sie in einem Interview, das heißt »die Spitzen und Kanten aus der Musik herausnehmen«, letztlich also »mehr Mainstream« bieten7.
Solche Worte klingen erstmal einleuchtend in Hinsicht auf ein Programm mit jungem Zielpublikum, das heutzutage schwerer denn je zu erreichen ist. In ihnen drückt sich allerdings ein Denkfehler aus: Wer würde heutzutage von einem privaten und gar erst von einem Streaming-Dienst zu einem öffentlich-rechtlichen Sender wechseln, weil dort exakt dieselbe Musik in der Rotation durchläuft?
Die Konkurrenz ist vielseitiger geworden, der Markt für den Musikkonsum wurde zunehmend durch digitale Angebote monopolisiert, die neben Musik auf ein breites Podcast-Programm und also radioähnliche Inhalte setzen. Mehr noch bieten sie ihrem Publikum Bequemlichkeit, wo früher noch Herausforderungen möglich waren – und machen zumindest das besser als das lineare Radio.
Wenn Seidel etwa in ihrem Interview über die »Durchhörbarkeit« von DASDING darauf pocht, dass ihr niemand sage, »dass draußen die Sonne scheint«, wenn sie ihre Spotify-Playlist durchstreamt, stimmt das nur so halb. Das bislang noch nicht in Deutschland ausgerollte Feature »AI DJ« von Spotify8 wird das schon bald können, sofern das Unternehmen das möchte.
Was die Streaming-Plattformen nämlich dem ÖRR insgesamt voraus haben, sind die gleichermaßen umfangreichen wie personalisierten Datensätze, auf deren Grundlage ihre Empfehlungslogiken funktionieren. Anderswo werden die Bedürfnisse noch per Telefonanruf geklärt.
Die große Markforschungshörigkeit
Das gerne vorgebrachte Argument, das Radio wäre irgendwie menschlicher und nahbarer als eine Streaming-Plattform, weil dort lediglich »der Algorithmus« die Musik aussuche, hinkt. Zum einen arbeiten Musikplaner:innen bei öffentlich-rechtlichen Hörfunk mit Programmen wie MusicMaster, das ebenfalls algorithmisch funktioniert und nach bestimmten Kriterien musikalische (Vor-)Auswahlen trifft. Das ist erstmal ein neutrales Hilfsmittel, das in den richtigen Händen zum nützlichen Werkzeug werden kann.
MusicMaster kann aber ebenso als ein sogenanntes Garbage-in-Garbage-out-System fungieren. Das kommt ganz darauf an, welche Parameter oder welche »Klangfarben« von Menschenhand voreingestellt werden, und nach welchen strategischen Kriterien dies wiederum erfolgt. Auch da zeigt sich auf praktischer Ebene eine Konvergenz zwischen ÖRR und privaten Anbietern: Dahinter stehen Optimierungsabsichten, die nicht immer zentral auf die Hörerfahrung zugeschnitten sind, sondern bisweilen gänzlich andere Ziele zu verfolgen scheinen.
Programmreformen wie die von DASDING werden gerne mit Marktforschung untermauert, die meistens per Telefon durchgeführt werden. Das System dieser Kurztests, bei denen Hörer:innen kurze Schnipsel vorgespielt werden9, ist bizarr und wurde in der Vergangenheit ebenso häufig wie zurecht kritisiert. Manche, wie etwa Arno Lücker in einer Artikelreihe über »Die Abschaffung des Kulturradios«10, sehen in derlei Umfragen und ihrem hypersuggestivem Framing gar eine »Best Practice in Self-fulfilling prophecy«.
Der konkrete Vorwurf lautet, dass die Umfragen mit keinem anderen Ziel durchgeführt werden, als eine Datengrundlage für die Rechtfertigung weiterer Einsparungen zu schaffen. Das von Lücker verwendete Beispiel, die Einführung von mehr sogenannter Neo-Klassik in die Rotation von rbb Kultur, wurde zwar mit einer Umfrage begründet. Sie kam beim Publikum allerdings überhaupt nicht gut an. Das verleiht seiner These umso mehr Gewicht.
Die Marktforschungshörigkeit des ÖRR spricht auf diese Art eine doppelte Kapitulation aus. Zum einen wird damit schätzungsweise ein Haufen Geld dafür aus dem Fenster geworfen, um welches durch Kürzungen wieder einzusparen. Zum anderen wird das eigene Programm entsprechend den privaten Angeboten muzakisiert, obwohl sich damit vermutlich kaum Publikum ziehen lassen wird.
Dabei liegt in der Konkurrenzunfähigkeit des ÖRR doch sein eigentliches Privileg. Wie es sich nutzen ließe, beweisen öffentlich-rechtliche Radiosender anderswo schon seit Jahren.
Die großen Vorbilder
Der Journalist Martin Hommel führte im Rahmen seines gemeinsam mit Kollegin Melanie Gollin betriebenen Projekts Wo ist hier der Krach?11 eine Reihe von Interviews mit öffentlich-rechtlichen Radiosendern aus anderen Ländern. Ihnen allen ist gemein, dass sie auf eine Form der inhaltlichen Ausrichtung und musikalischen Programmierung setzen, wie sie als Alternative zu den Privaten statt als Wettbewerber zu verstehen sind. Nicht wenige von ihnen können als Leuchttürme angesehen werden.
Ein roter Faden, der sich durch die Gespräche zieht: Marktforschung wird bei Sender wie Double J in Australien12 oder BBC Radio 6 Music in Großbritannien13 schlicht nicht durchgeführt. Stattdessen wird viel gemacht und ausprobiert, wobei nicht etwa eine homogene Mehrheitsgesellschaft die Adressatin ist. »Nicht Programm für jene, die sich für den Mainstream interessieren, sondern halt alle, alle«, bringt die Programmchefin des österreichischen Senders FM4 Dodo Gradištanac auf den Punkt, worin die eigentliche Aufgabe jedes öffentlich-rechtlichen Angebots liegt.
Und darin besteht letztlich der Vorteil gegenüber einer Plattform wie Spotify, deren »Algorithmus« aus nichts weiter als in Code übersetzte Geschäftsinteressen besteht. Musik wird insbesondere von dieser Plattform als Lockmittel eingesetzt, um den Menschen personalisierte Werbung in die Gehörgänge zu pumpen. Es wäre allemal strategisch sinnvoller, den ÖRR als Alternative zu kommunizieren, der sich an eine heterogene Gemeinschaft richtet. Als Musikprogramm, das nichts verkaufen und sich dementsprechend nicht anbiedern will. Das Möglichkeiten zum Zuhören und nicht allein zum Durchhören gibt.
Gerade aber solche Programme werden nun immer weiter im Sinne der Durchhörbarkeit gestrichen, obwohl sie meistens nicht einmal kostspielig sind. Was es braucht, ist ein ganz anderes Kapital: charakterliches. Das Beispiel Großbritannien etwa zeigt, wie erfolgreich Personality-Shows sein können. Mit John Peel, Mary Ann Hobbs und Benji B beispielsweise hat die BBC verschiedene Generationen von Moderator:innen großgezogen, die einen nachhaltigen Einfluss auf das kulturelle Leben des Landes hatten und die Menschen effektiver ans Radio banden, als jede Ansage zum Wetter da draußen es könnte.
Mehr noch hat Radio 1 mit dem BBC Essential Mix eine Institution geschaffen, die in der Szene für Dance Music einen internationalen Stellenwert hat. Was über die jeweiligen DJs automatisch eine jüngere Zielgruppe ans Radio heranführt, wie sie der ÖRR doch eigentlich auch gerne hätte. Doch findet weder ein wirklicher Aufbau von Radio-Persönlichkeiten aus dem Nachwuchs statt, noch wird in vergleichbarer Art auf Multiplikator:innen gesetzt, die tatsächliche Zugkraft haben.
Es gibt genügend Vorbilder dafür, wie Radio anders und sogar erfolgreicher gemacht werden könnte, wenn der Erfolg nicht an der Konkurrenz gemessen wird. Stattdessen wird sich lediglich an der neuerlichen Streichungslust im BBC-Programm ein Vorbild genommen14 und eine sukzessive Verödung des ÖRR in die Wege geleitet.
Die große Verkrustung
Nun lässt sich freilich einwenden, dass selbst das innovativste Konzept auf dem Rücken eines Auslaufsmodells den sich stellenden und allen möglichen Aufgaben nicht gerecht werden kann. Womit wir nur eben erneut beim Problem der »Mitarbeitenden« angekommen wären: Jeder Einschnitt in ihrem Arbeitsalltag, jede Doppelt- und Dreifachbelastung bei der Umsetzung »trimedialer« Formate verunmöglicht ihnen, neue Projekte anzugehen und umzusetzen oder sich auch einfach nur Ideen einzubringen.
Verkrustete Strukturen erledigen den Rest. Wie das aussieht, habe ich vor einigen Jahren selbst bei einer Gesprächsrunde erfahren15, an der auch Kai Gniffke teilnahm und in der es ebenfalls um die Zukunft ging – die des Musikjournalismus insgesamt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt nur zu ein, zwei Gelegenheiten für den ÖRR gearbeitet und bekam also einen ungefilterten Eindruck davon, wie in den Entscheidungspositionen so über die Welt gedacht wird.
Vor seiner denkmalgeschützten Schrankwand sinnierte Gniffke darüber, ob der SWR in der Stadt mit dem größten Migrantenanteil Deutschlands denn »deren Themen« habe. Dass der Fehler bereits in der Formulierung steckte und es vielleicht gut täte, statt langwieriger Marktforschung einfach mal persönlich in der Nachbarschaft herumzufragen, ein paar Leute zu Feedback-Gesprächen einzuladen oder ihnen Sendezeit zu überlassen, um das einfach mal auszuprobieren – das sind alles Sachen, die ich in dem Moment gerne erwidert hätte.
Nicht, dass ich auf offene Ohren gestoßen wäre. Von meinem Hinweis, auf einem Panel über die Zukunft des Musikjournalismus mit 33 Jahren der jüngste Teilnehmer zu sein, obwohl zuvor Student:innen innovative Konzepte für digitale Darstellungsformen präsentiert hatten, ließ sich Gniffke nicht stressen. Kein geplatzter Kragen, nur ein herzhafter Lacher war die Antwort. Vergleichbarem müssen in den vergangenen Jahrzehnten ständig »Mitarbeitenden« ausgesetzt gewesen sein, wann immer sie die Hackordnung hinauf ihre Ideen kundgetan haben.
Zweifelsfrei bedeutete die mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche einhergehende mediale Umwälzung ein riesiges Problem für den ÖRR, nachdem er jahrzehntelang nicht auf andere Distributionskanäle angewiesen war, sondern im Grunde sein eigener war. »Transformationsprozesse« hin zu einem digitalen Angebot, das die Menschen anspricht, hätten sich jedoch auch von unten her anstoßen statt von oben verordnen lassen.
Der große Plan
Gniffke verspricht immerhin, die ARD zum »relevantesten Streaming-Anbieter in Deutschland« zu machen, und zwar bis zum Ende des Jahrzehnts. Um »Nutzerfreundlichkeit« ginge es dabei, sagte er kurz nach dem ZAPP-Roundtable in einem offenbar von seiner Pressestelle halb tot redigierten Interview16.
Das impliziert eine Zentralisierung des Angebots, den Einsatz von »Empfehlungslogiken« (lies: »der Algorithmus«), im Grunde also analog zur Muzakisierung des Programms eine Spotification des öffentlich-rechtlichen Angebots insgesamt. Das würde auch erlauben, noch ein paar Sparmaßnahmen vorzunehmen und noch ein paar »Mitarbeitende« umso prekärer oder aber gleich obsolet zu machen.
Wie das aussieht, zeigt sich bereits nicht nur im kaputtreformierten rbb. Die Kulturchefin des NDR, Anja Würzberg, hat sich bereits kontrolliert verplappert und das Ganze als zentralisierten Streamlining-Prozess entlarvt.17 Auch der Bayerische Rundfunk derweil setzt schon mal vorsorglich die Schere an und entledigt sich bis Januar 2024 zahlreicher Kulturformate.18 Es fiele nicht nur schwer, sondern wäre geradezu unlogisch, zwischen all dem keinen Zusammenhang zu sehen.
Wäre das alles zu verkraften, wenn am Ende ein gestärkter ÖRR aus der Sache herausginge, der die Bevölkerung erreicht, vollumfänglich über das Weltgeschehen und die Entwicklungen vor der eigenen Haustür informiert, sie herausfordert und unterhält? Der sich endlich unabhängig vom Markt etabliert und vielleicht die ebenfalls scharf kritisierten Verwicklungen mit der Politik auflösen kann? Vielleicht.
Nur scheint mindestens ersteres nicht der Plan eines ARD-Vorsitzenden zu sein, der aktuell darüber sinniert, ob sich nicht eines Tages »im digitalen Bereich Möglichkeiten für Werbung eröffne[n]« und sich vorstellt, dass seine eierlegende Wollmilchsau obendrein »andockfähig [...] für andere Medienanbieter« werden kann.
Das sind vielmehr die Worte von jemandem, der irgendwie in Konkurrenz zu wie auch in Kollaboration mit privaten Anbietern auf einem Markt mitmischen will, den er – wie schon seine Vorgänger:innen – nur von außen kennt. Und der entweder nicht verstehen oder aber leugnen will, dass diese Anbiederung einer Kapitulation gleichkommt.
Freilich: Die fehlenden finanziellen Mittel, die verkrusteten bürokratischen Strukturen, die verpassten Chancen sowie die individuellen Verfehlungen und Fehlentscheidungen aus der Geschichte des ÖRR werden sich keineswegs so einfach beseitigen und überkommen lassen, ohne wirklich maßgeblich etwas zu verändern. Und immerhin: Der im März berufene Zukunftsrat, bei ZAPP von der Medienmanagerin Julia Jäkel vertreten, soll mit seinen Empfehlungen Reformen vorschlagen, die den ÖRR wieder auf Kurs bringen.
Es scheint dennoch mehr als wahrscheinlich, dass sie auf den Rücken von »Mitarbeitenden«, vor allem den vielen Festen Freien an der Basis des Systems, ausgetragen werden. Diejenigen also, denen bereits »verdammt viel abverlangt« wird und die selbst – bezeichnender geht es kaum – im Zukunftsrat keinen Sitz haben. Vielleicht jedoch wäre die innovativste Idee, zuallererst in sie zu investieren.
1 https://youtu.be/I5uduxDzseE
2 https://www.ard.de/die-ard/was-wir-leisten/Mitarbeiterinnen-und-Mitarbeiter-in-der-ARD-100/
3 https://www.ard-freie.de/60-2
4 https://www.radioszene.de/143526/ndr-sparmassnahmen.html
5 https://www.morgenpost.de/berlin/article237730601/Welche-Sendungen-der-RBB-aus-dem-Programm-streicht.html
6 https://www.turi2.de/community/epd-medien/weniger-raum-fuer-gegenkultur-rene-martens-ueber-das-aus-des-arte-magazins-tracks/
7 https://www.dwdl.de/interviews/89153/mit_musikalischer_vielfalt_stellen_wir_niemanden_richtig_zufrieden/
8 https://www.giga.de/artikel/spotify-ai-dj-playlist-mit-ki-moderator-so-gehts/
9 https://uebermedien.de/2011/musik-nur-wenn-sie-mau-ist/
10 https://blogs.nmz.de/badblog/2021/05/05/die-abschaffung-des-kulturradios-folge-4-wie-man-rbbkultur-und-co-abschaffen-will-und-wie-man-hoererinnen-studien-in-den-sand-setzt/
11 https://woisthierderkrach.de/
12 https://woisthierderkrach.de/double-j
13 https://freshonthenet.co.uk/brokenback/
14 https://woisthierderkrach.de/bbc
15 https://www.youtube.com/watch?v=9_LGD2-_6hY&t=6105s
16 https://www.horizont.net/medien/nachrichten/horizont-kongress-wie-sich-kai-gniffke-die-neue-ard-vorstellt-211012
17 https://musikunrat.de/2023/06/26/hinterhaeltig-kulturtaktik-im-ard-hoerfunk-der-geplante-unfall-anja-wuerzbergs/
18 https://www.abendzeitung-muenchen.de/kultur/kultur-kahlschlag-beim-bayerischen-rundfunk-sender-reagiert-art-917423