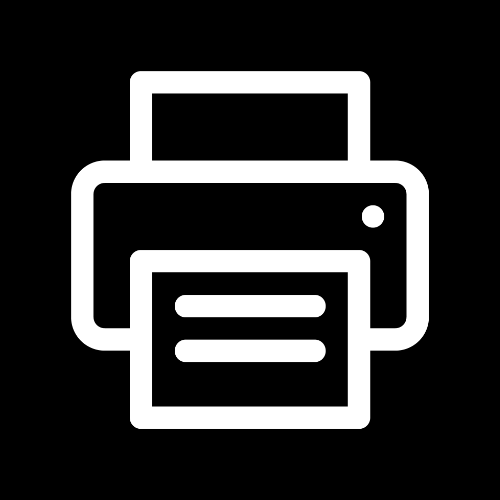Keine Freiräume ohne Komplexität - Zu Entstehung und Verlauf von „Klangteppich. Festival für Musik der iranischen Diaspora“
Franziska Buhre, Veröffentlicht: 26. Juli 2023
(Aktualisiert: 12. August 2023)
In ihrem Essay zeichnet Franziska Buhre gesellschaftliche, historische und ästhetische Bedingungen nach, die ihr bei der Arbeit als Kuratorin begegnen. Nur in der Offenlegung, und Auseinandersetzung mit einer Reihe an Fragestellungen und Begriffen kann ein Festival gelingen, meint sie.
Am Nachmittag des 10. Februar 2018 erhalte ich folgende Nachricht: „Strange thing happened. R.’s dad died today! Why? Very strange. Probably not natural.“ Das ist der Moment, in dem mich das bislang ferne Grauen, das abstrakte und verdrängte Wissen aus den Nachrichten persönlich trifft. Seit Monaten bereite ich gemeinsam mit einem iranischen Musiker in Berlin ein Konzert für die Indierock-Band von R. aus Iran vor, das erste des Sängers und Bandleaders in der Hauptstadt. Ich habe die Spielstätte organisiert und kümmere mich um die Pressearbeit, der Mistreiter ist im Austausch mit den Musikern in Teheran. Wir machen das freiwillig, das Vorhaben kann kurzfristig ohnehin nicht gefördert werden. Das Konzert soll am 8. März stattfinden, dem Internationalen Frauentag.
Was war passiert? Der Vater von R., ein prominenter Naturschützer in Iran, war am 24. Januar verhaftet und im Teheraner Evin-Gefängnis inhaftiert worden. Mit ihm wurden andere Umweltschützer_innen verhaftet, die – verurteilt zu hohen Strafen wegen „Spionage“ und „Korruption auf Erden“ - noch heute in Evin gefangen gehalten werden. R.’s Vater hatte, ebenso wie er selbst, die kanadische und iranische Staatsbürgerschaft. Die iranischen Behörden behaupteten, er habe in seiner Zelle Selbstmord begangen, seine Familie stellt das infrage.
Die Bandkollegen von R. kannten seinen Vater und hatten die Familie auf Reisen durch Iran begleitet. Somit gerieten auch sie ins Visier der iranischen Revolutionsgarden.
Sollten wir abwarten oder das Konzert in Berlin absagen? Eine Woche später war klar, dass R. Iran nicht würde verlassen, seine Bandkollegen und ein Singer-Songwriter aus Teheran in Berlin aber auftreten können. Wir diskutierten in Emails und Chats, ob wir beim Konzert verdeckt Spenden sammeln könnten für die Stiftung zum Wildtierschutz, die R.’s Vater gegründet hatte, doch sie stand nun auf dem Index des iranischen Regimes. Auch der Internationale Frauentag sollte aus Schutzgründen für den Singer-Songwriter nicht am Konzertabend thematisiert werden.
Von Berlin aus organisierten die Bandkollegen von R. ihre Flucht nach Kanada. Sie konnten sich dabei auf Netzwerke verlassen, die ich 2018 noch nicht hatte. Nach sechs Jahren Beschäftigung mit Musiker_innen aus Iran und der iranischen Diaspora habe ich mittlerweile zumindest gewisse Kontakte in Ministerien, an die ich mich wenden kann, wenn ein_e Künstler_in Schwierigkeiten beim Antrag auf ein Visum bekommt oder möglicherweise in Gefahr gerät.
Performanz und „Meisterschaft“
Im vorhergehenden Sommer 2017 brachte mir jemand die Rahmentrommel Daf aus Iran mit. Mit iranischen Instrumenten hatte ich mich zuvor nicht eingehend beschäftigt und war erstaunt, wie viele Saiten- und Perkussionsinstrumente ich bis dato nicht kannte. Durch Zufall lernte ich iranische Musiker_innen, ihre Praxis und Lebenswelten in Berlin kennen. Aus dem Studium der Tanzwissenschaft und Theaterwissenschaft habe ich den Begriff der Performativität verinnerlicht. Danach ist die Aufführung ein einmaliges Ereignis, an dem Publikum und Künstler_innen beteiligt sind und eine eigene Bedeutung entsteht. Ein Werk existiert in der Aufführung nicht, es gilt, sie selbst wahrzunehmen. Diesen Ansatz auf Konzerte anzuwenden, scheint mir besonders sinnvoll, ich suche nach einer Sprache, um zu beschreiben, was in der Aufführung eigentlich passiert. Ich verstehe, dass es Räume gibt, zu denen ich als weiße Deutsche keinen Zugang haben soll, und wo Menschen der iranischen Diaspora unter sich sein möchten. Einmal ging ich zu einem Konzert in einer Schulaula, wo Nachwuchsmusiker_innen verschiedener iranischer Instrumente und ihre Lehrer_innen spielten. Im Publikum war ich der einzige Mensch mit blonden Haaren und fragte mich, warum nicht auch andere Nachbar_innen, Bekannte und Musikinteressierte von diesem Konzert erfahren hatten.
In solchen Konzerten wird meist die so genannte klassische persische Musik aufgeführt, die von einem „Meister“ (pers. Ostad) an seine Schüler_innen weitergegeben wird. Mit dem Anspruch an die Aufführung einer Form von Hochkultur geht eine Atmosphäre aus Würdigung und Demut einher, mit dem entsprechenden Gefälle an Autorität zwischen Musiker_innen und Publikum sowie zwischen „Meister“ und Schüler_innen. Darin fügte ich mich 2018 ein, schließlich bewundere auch ich, wenn jemand sein Instrument kunstfertig beherrscht. Jedoch überraschte mich schon damals, dass es weder für die Musizierenden noch für das Publikum einen Unterschied zwischen der Aufführung klassischer persischer Musik in Iran und an einem Ort in Deutschland zu geben schien. Ich weiß um die Kraft der Musik, in Erinnerungen zurückzuversetzen, an bestimmte Orte und hinein in liebenswerte Erlebnisse, kann aber nicht ermessen, wie wichtig das Konzert Menschen sein mag, die Iran verlassen mussten oder aus einer Vielzahl anderer Gründe nach Deutschland gekommen sind. In meiner Wahrnehmung entsteht in der Aufführung aber etwas anderes, die Musik kann hier nicht so erklingen wie in Iran, bedingt durch die Räume, die Lebensumstände von Künstler_innen und Publikum, die Gesellschaft, in der wir uns hier bewegen. Im Vordergrund steht nicht der Genuss am einmaligen Ereignis, sondern die Aufführung muss eine als Tradition mit festen Regeln verstandene Kulturpraxis verkörpern. Verschwindet dahinter nicht der individuelle Ausdruck, die Freiheit zur Aufnahme einer Vielzahl von Einflüssen in die künstlerische Gestaltung und zu Entscheidungen im Moment? In der Annahme, ein „authentisches“ Konzert zu hören, liegt auch eine Form des Selbstbetrugs, der fraglos eine heilsame Funktion einnehmen kann. Nostalgie kann eine treibende Kraft sein, die Vergänglichkeit und Schönheit eines Augenblicks zu zelebrieren. Ich bezweifle jedoch, dass sie im Augenblick der Aufführung produktiv in Performativität eingelöst werden kann.
Neben diesen eher ästhetischen Überlegungen erfuhr ich von den umfangreichen Kommunikationsmitteln, welche Musiker_innen der iranischen Diaspora nutzen, um mit Familienmitgliedern, Freund_innen und Kolleg_innen in Iran und weltweit im Austausch zu bleiben. Auch diese, so mein Eindruck, wirkten sich auf die künstlerische Praxis aus: es gibt Alben, die gemeinsam mit Musiker_innen in Iran produziert werden, andere Künstler_innen binden klangliche Referenzen wie Field Recordings aus Iran oder klassische persische Musik ein, veröffentlichen Textbeiträge über Lebens- und Arbeitsbedingungen oder beauftragen für die grafische Gestaltung und Visuals einer Produktion eine_n Künstler_in aus Iran. Wie anderen Künstler_innen mit Einwanderungsbiografien, ist auch Iraner_innen in Deutschland der Zugang zu Auftrittsmöglichkeiten, Förderungen und Vernetzung in andere Musikszenen vielfach erschwert. Und noch immer fordern Veranstalter_innen die Erfüllung bestimmter Klischees über „orientalische“ Musik oder exotistisch verklärte „verbotene“ Praktiken, wie dem Gesang von Frauen vor einem gemischten Publikum in Iran. Manche Künstler_innen arrangieren sich damit, nutzen Begriffe wie „Naher Osten“ oder „orientalische Musik“ in ihren Selbstbeschreibungen und stellen ihre Virtuosität in exotisierenden Festivalkontexten wirkungsvoll zur Schau.
Eurozentrismus und „klassische Musik“
Mit Kategorisierungen im Musikbetrieb habe ich grundsätzlich Schwierigkeiten. Genre-Bezeichnungen, Adjektive oder Eingrenzung auf eine Herkunft mögen in kurzen journalistischen Beiträgen oder Programmtexten hilfreich sein, verraten aber nichts über Klänge und wie diese erzeugt und aufgeführt werden. Zudem stelle ich, auch immer wieder bei mir selbst und bedingt durch meine Schulbildung und Sozialisation, erhebliche Defizite im Wissen um Instrumente fest, die nicht im Rahmen europäischer Orchester-, Kirchen-, Militär- und Volksmusik entwickelt wurden. Obwohl allein schon mit Blick auf das Schlagwerk bemerkt werden muss, wie viele nicht-europäische Instrumente und Materialien in sein Inventar eingewandert sind beziehungsweise diesem angeeignet wurden. Ohne den europäischen Kolonialhandel und den Raubbau an Rohstoffen für den Instrumentenbau wäre das Konzertwesen in Europa nicht zu der Bedeutung gelangt, die es seit jeher beansprucht. Nur langsam entsteht dafür in der Instrumentenkunde, Musikwissenschaft und Ethnologie, unter Musiker_innen und Publikum ein Bewusstsein. Der hegemoniale Anspruch europäischer Musik hat sich zum Teil stark auf andere Musikkulturen ausgewirkt. Die „moderne Form“ der iranische Stachelgeige Kamancheh beispielsweise gilt als Instrument mit vier Stahlsaiten.1 Demgegenüber hatte das vorherige Instrument drei Saiten aus Seide. Diese Entwicklung ist dem vermehrten Import europäischer Geigen nach Iran zuzuschreiben, und zwar nach der erstmaligen Teilnahme Persiens an der Weltausstellung 1873 in Wien. Um auch europäische klassische Musik spielen zu können, wurde der Kamancheh eine vierte Saite hinzugefügt und ein Musiker und Komponist wie der bekannte Abolhasan Saba (1902-1957), Leiter der ersten staatlichen Musikschule in Rasht in der nördlichen Provinz Gilan, wechselte von der Kamancheh schließlich zur Violine.
Gründung und Hintergründe
Meine Beweggründe zur Entwicklung eines Festivals für Musik der iranischen Diaspora waren also ein Bewusstsein für Performativität jenseits definierter Rahmenbedingungen und die Überzeugung, dass zum Beispiel Instrumente aus Iran hierzulande voraussetzungslos in einer Aufführung erlebt werden können. Zudem schienen mir bislang festgestellte, interdisziplinäre Arbeitsweisen aussichtsreich für die Entwicklung neuer Projekte. Seit 2017 ist mein Anliegen, eurozentrische Narrative und Zuschreibungen zu überwinden.
„Klangteppich. Festival für Musik der iranischen Diaspora“2 präsentiert daher Uraufführungen in Berlin erarbeiteter Projekte von iranischen Künstler_innen gemeinsam mit Künstler_innen anderer Spielweisen und Disziplinen. Das Programm entsteht im Austausch über Ideen der Künstler_innen, die sie gerne umsetzen möchten und Ideen von mir, die ich an Künstler_innen herantrage und dafür neue Begegnungen der Mitwirkenden initiiere. Das Festival fragt nicht danach, was sie als Iraner_innen „mitbringen“, sondern nach ihren gegenwärtigen Praktiken. Es schafft Aufmerksamkeit für unterrepräsentierte Perspektiven und Schaffensweisen und fördert ihre Teilhabe an Öffentlichkeit und Netzwerken.
Viele Künstler_innen der iranischen Diaspora, so meine Beobachtung, haben in Iran zunächst Studiengänge nicht-künstlerischer Fächer absolviert und Tätigkeiten in anderen Berufen ausgeübt, und die künstlerische Praxis begleitend seit der Kindheit, Jugend oder als konkretes Ziel eines weiteren Studiums im Ausland. Andere haben in Iran künstlerische Abschlüsse erworben, sind umgekehrt im Ausland aber gezwungen, andere Tätigkeiten auszuüben. Oder sie streben einen nicht-künstlerischen Hochschulabschluss im Ausland an und versuchen, sich den Freiraum für die künstlerische Praxis zu erhalten. Als Künstler_in mit Einwanderungsgeschichte aus dem globalen Süden in Deutschland Fuß zu fassen, ist mit sehr viel mehr Hürden verbunden als für „weiße“ Künstler_innen. Daher ist nachvollziehbar, dass die künstlerische Praxis in der Diaspora sichtbar wird, wenn die Künstler_innen Ende zwanzig oder über dreißig Jahre alt sind.
In den 1980er Jahren in Iran geborene Kinder wuchsen während des Iran-Irak-Krieges auf oder ihre Familien flüchteten wegen des Krieges ins Ausland, andere Eltern haben in den 1970er Jahren in Opposition zum Schah-Regime Iran verlassen oder nach der Islamischen Revolution 1979.
Und infolge der Unterdrückung der Demokratiebewegung („Grüne Bewegung“) von 2009 und der Niederschlagung der Proteste gegen das Regime 2019 haben insbesondere junge Menschen Iran verlassen, die für sich im Land keine Zukunft mehr sehen.
Die meisten der an fünf Ausgaben von Klangteppich beteiligten Künstler_innen sind in den 1980er und 1990er Jahren geboren. Wenn sie die Repressionen des iranischen Regimes nicht selbst erlebt haben, erfuhren sie diese von ihren Eltern, Verwandten, Freund_innen oder Bekannten. Über das erfahrene Leid konnten viele Ausgewanderte über Jahrzehnte nicht sprechen oder ihre Kinder fanden keinen Zugang zur Spurensuche in der Vergangenheit. In Deutschland kann die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur und dem SED-Regime, wie sie von Persönlichkeiten wie Fritz Bauer, Beate Klarsfeld, Roland Jahn oder Bärbel Bohley aufgezeigt wurde, einen Eindruck vermitteln, wie Geschichten von Gewalt, Unrecht und Stillschweigen vergegenwärtigt, und welche Gemeinsamkeiten daraus generationsübergreifend abgeleitet werden können, und zwar als bewusster Bruch mit Erinnerungskulturen, die nur bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zugeordnet werden.
Deshalb habe ich 2022 Künstler_innen in zwei Projekten eingeladen, ihre Erinnerungen an deutsch-iranische Familiengeschichten in eine Aufführung zu transformieren. Auch vor dem Hintergrund, dass solche Aufführungen noch immer viel zu selten auf Musikfestivals stattfinden, anders als etwa auf Theaterbühnen. Mein dreimonatiger Aufenthalt in Tadschikistan 2019 hat mir eine vertiefte Perspektive auf das koloniale Erbe der Sowjetunion, die damit einhergehende Unterdrückung ethnischer und religiöser Minderheiten und die seit der Unabhängigkeit des Landes zunehmende, nationale Identitätspolitik mit faschistischen Tendenzen – Präsident Emomali Rahmon konsolidiert einen persisch-arischen Ursprungsmythos – eröffnet.3 So blicke ich nicht nur auf die Diktaturen in Deutschland zurück, sondern erweitere den Blick auf Kulturschaffende, die aufgrund ihrer Erfahrungen, zum Beispiel in ehemaligen Sowjetrepubliken, mit Kulturschaffenden der iranischen Diaspora eine gemeinsame Ebene herstellen können. Für mich ist das ein weiteres Mittel, wie eine Festschreibung auf Herkunft überwunden werden kann. Denn diasporische Lebens- und Schaffenswirklichkeiten sind seit vielen Jahrzehnten Teil der Gesellschaft in Deutschland.
Hinhören und Abwägen
Zum Festival oder anderen Musikprojekten habe ich in den vergangenen Jahren auch Künstler_innen aus Iran eingeladen und schließe diese Möglichkeit künftig auch nicht aus.
Jedoch kann ich ihre Musik nur medial vermittelt rezipieren. Beim Hören suche ich nach einem Gespür für Klang im Raum und Atmosphären, nach Erfahrungen in der Aushandlung einer Aufführung zwischen Künstler_innen und Publikum. Dass viele der Aufnahmen – und ich maße mir keinen umfassenden Überblick an – nicht diesen Eindruck vermitteln, erklärt sich für mich durch die mangelnden Auftrittsmöglichkeiten in Iran, denn Konzerte können nur nach langwierigen Genehmigungsverfahren stattfinden, gemischte Ensembles von Männern und Frauen sind rar, und es ist fraglich, wer sich in Zeiten gesellschaftlichen Aufruhrs und einer stetig steigenden Inflation überhaupt auf einen Konzertbesuch einlässt und die finanziellen Mittel dafür aufbringen kann.
Also produzieren viele Künstler_innen Musik in Aufnahmestudios oder zu Hause, und veröffentlichen sie unter durch Sanktionen erschwerten Bedingungen auf digitalen Plattformen.
Mein Anspruch gilt dem unwiederholbaren, sinnlichen Moment der Live-Aufführung, das für mich wesentlich im Umgang mit Klang im Raum besteht. Folglich präsentiere ich keine fertigen Konzertprogramme oder Alben als Live-Set sondern Uraufführungen, die auch Kompositionsaufträge an Künstler_innen in Iran umfassen können. Einfacher als die Abwägung, ob und wie ich Künstler_innen aus Iran am Festival beteiligen kann, gestaltet sich die Arbeit im Hintergrund, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Immer mal wieder schreibe ich Einladungen oder Empfehlungsbriefe, ich empfehle Künstler_innen aus Iran und der iranischen Diaspora an Veranstalter_innen, organisiere ehrenamtlich Konzerte, deren gesamte Einnahmen den Künstler_innen zugute kommen, berate zu Förderanträgen oder schreibe Pressetexte für Ensembles. Mich erreichen Anfragen und ich teile, was ich weiß, ohne davon auszugehen, mein Wissen oder meine Einschätzungen seien allgemein anwendbar.
Lernen aus Konflikten und Angst
Zur Konfrontation mit komplexen Fragestellungen und Hintergründen gehören im Rahmen der kuratorischen Praxis die Bereitschaft zum Umdenken und die Offenheit für Rückschläge. Wenn Ende September 2022 eine in Deutschland lebende Komponistin, die im Jahr zuvor bei Klangteppich zu Gast war, in ihren sozialen Medien die Rede eines AfD-Politikers aus der Bundestagsdebatte zu Iran teilt, deren Rhetorik stark an die nationalsozialistische Faszination für den persischen Arierkult erinnert, und die Komponistin auf Nachfrage sagt, es sei ihr egal, welcher Partei er angehöre, er habe Recht, oder sich ein anderer iranischer Komponist als Monarchist entpuppt, ist für mich eine erneute oder künftige Zusammenarbeit ausgeschlossen.
In neuen Zusammenarbeiten entstehen mitunter kräftezehrende Konflikte, die den Künstler_innen erschweren, sich auf den künstlerischen Prozess zu konzentrieren. Zur Entlastung aller Beteiligten und für die Prozessbegleitung habe ich seit 2022 eine Mediatorin im Team, die psychologische Fachkenntnisse und Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und Persisch hat.
Nach destruktiven Erfahrungen, die nicht nur mich, sondern auch Projekte des Festivals in Bedrängnis brachten, habe ich inzwischen keine Toleranz mehr für toxische Männlichkeit. Die oben beschriebene Kultivierung des Machtgefälles, die ein als Ostad ausgebildeter Musiker mitunter von seinen hiesigen Kolleg_innen erwartet, hat im Rahmen des Festivals keinen Platz mehr. Denn auch das gehört zur Wirklichkeit: zu erkennen, dass die Geschlechter-Apartheid in Iran, die systemische Entrechtung von Frauen und die Bevorzugung von Söhnen und Männern im privaten, rechtlichen und öffentlichen Raum – neben vielen anderen Anzeichen toxischer Männlichkeit übersteigerte Selbstwahrnehmungen, Überlegenheitsgefühle und mangelnde Kooperationsbereitschaft begünstigen. Diese Erwartung habe ich dann doch: dass sich alle Künstler_innen in einem geschützten Umfeld auf Augenhöhe begegnen können und dass Aufgaben, die nun einmal mir zufallen, nicht als Infragestellung einer Persönlichkeit betrachtet werden.
Angst hat das Festival bis 2023 begleitet. Wenngleich ich bei den ersten Ausgaben keine Verbindung herstellen konnte zur Sorge um die im März 2018 in Berlin auftretenden Musikern aus Teheran, wie eingangs geschildert. Wohl habe ich mir kaum vorstellen können, was sie durchmachen und Details wurden mir aus Vorsicht erspart. Die Angst, dass ihnen oder ihren Familienangehörigen und Kolleg_innen in Iran etwas passiert, war diffus und wenig greifbar. In den Jahren darauf erzählten mir Musiker_innen ihre Geschichten von Flucht, Bedrohungen und Verhören. Und leider wurde ich während meines Besuchs in Iran im Februar 2022 für Kontaktpersonen zum Sicherheitsrisiko – ich weiß bis heute nicht, warum. Auch ich wurde zwei Mal „befragt“, mutmaßlich von Revolutionsgardisten. Sie konnten mir auf Nachfrage nicht sagen, wogegen ich verstossen haben sollte und befahlen mir die Ausreise innerhalb von zwei Tagen. Eine Politologin hat mir das so erklärt: das iranische Regime sieht kulturellen Austausch als potentielle Bedrohung an. Die Verständigung von Menschen sei nicht erwünscht, denn es könnten neue Perspektiven eröffnet werden, welche die Ideologie, die Werte, den Fortbestand des Systems infrage stellen. Ich erinnere mich an die panischen Anweisungen der Moderatorin unser Diskussion beim Festival 2021, es dürfe auf gar keinen Fall über politische Themen gesprochen werden. Sie sei unpolitisch und wolle ihre Familie in Iran nicht gefährden. Seit Beginn der Proteste in Iran im September 2022 äußert sie sich offen, ebenso wie einige Künstler_innen, Politiker_innen oder Aktivits_innen mit Einwanderungsbiografien aus Iran. Das befreiende Sprechen geht einher mit dem Wissen, nicht wieder nach Iran reisen zu können, solange dieses Regime an der Macht ist.
Am 15. September 2022 veröffentlichte ich unter anderem Namen einen Artikel zu einer, von der Berliner Senatsverwaltung für Kultur geförderten Veranstaltung, an welcher die Kulturabteilung der iranischen Botschaft beteiligt war. Ich hatte Angst. Doch die ist vorbei. Ich lasse sie nicht mehr hineinkriechen in Überlegungen, wen ich zum Festival einladen könnte oder nicht, ob ich in Worten rund um das Festival zurückhaltend sein sollte, welche Vorsichtsmaßnahmen ich treffen sollte, falls Menschen des iranischen Regimes beim Festival auftauchen, wie ich mit der mutmaßlichen Überwachung meiner Aktivitäten umgehe. Das Festival hat keine politische Agenda, im Vordergrund stehen die künstlerischen Projekte. Wer dabei sein möchte, kann sich auf Fairness verlassen und die Bühne nutzen. Die Beteiligten entscheiden selbst, ob und wie sie sich äußern möchten. Dass einige Künstler_innen nach der ersten Begegnung weiter gemeinsam arbeiten, verstehe ich als Beleg für die Substanz der Projekte, unabhängig von meinen ersten Ideen.
Offene Zukunft
Das Festival kann nur durch Förderungen verwirklicht werden und ich bin froh, dass fünf Ausgaben mithilfe der Förderungen von Musicboard Berlin bis zur Kulturstiftung des Bunde gelungen sind.
Der Aufwand für Planung, Konzeption und Einreichung von Förderanträgen und schließlich der Durchführung ist erheblich, und mit anstehenden Prüfungen der Verwendungsnachweise auch bis zu zwei Jahre danach nicht abgeschlossen. Ich kann diesen Aufwand nur betreiben, weil ich als freie Journalistin arbeite und die große Unsicherheit, ob der nächste Antrag bewilligt wird, zehrt an meinen Kapazitäten.
Selbstverständlich weiß ich mich damit in guter Gesellschaft mit anderen Kurator_innen und Veranstalter_innen. Aufgrund der großen Umbrüche im Musikleben frage ich mich, ob ein Festival, das weiterhin stattfindet, wie es zuvor stattgefunden hat, die Antwort sein kann auf Bedürfnisse von Künstler_innen und Publikum, die heute differenzierter sind als noch vor Jahren und längst nicht mehr nur künstlerische Ausdrucksformen umfassen. Die Arbeit von Jahr zu Jahr hindert an der Entwicklung längerfristiger Vorhaben, die für eine Nachbarschaft, eine Gemeinschaft von Menschen oder zur vertieften Beschäftigung mit einem gesellschaftlich relevanten Thema Bedeutung entfalten kann. Klangteppich kann wiederkehren als Festival, als einzelne, fokussierte Veranstaltungen oder Feste mit Gäst_innen der iranischen Diaspora aus dem Ausland. Der gewachsene Zuspruch unterstreicht, dass sich Klangteppich nicht mehr beweisen muss und für Freiräume, bewegende Live-Erlebnisse und neue Verständigungen über unser Miteinander steht.
Im Herbst 2018 habe ich mir in Teheran eine Daf mit Naturfell gekauft. Ich habe sie und jene mit Plastikfell jahrelang nicht gespielt. Vor wenigen Wochen habe ich beide wieder in die Hände genommen und festgestellt, dass meine mit Naturfell viel stimmiger, tiefer und voller klingt als die erste, die ich für perfekt gehalten hatte. So begreife ich den Lernprozess in Verbindung mit Iran seit 2017 – als beständig im Werden.
- Vgl. During, J., Atayan, R., Spector, J., Hassan, S., & Morris, R. (2001). Kamāncheh. Grove Music Online.
https://www.klangteppich.berlin/en/klangteppich-v/ - Vgl zur Einführung: Kriege und Konflikte; Tadschikistan, Bundeszentrale für politische Bildung 2021
https://www.bpb.de/themen/kriege-konflikte/dossier-kriege-konflikte/54708/tadschikistan/